Wie wir uns fühlen, hat einen großen Einfluss auf alles, was wir so tun.
Für uns als menschliche Wesen spielen unsere Emotionen eine wesentliche Rolle und oftmals ist uns diese gar nicht vordergründig bewusst.
Wir nehmen wahr, wie wir uns fühlen – aber nicht immer, woher diese Regungen kommen oder welche teils weitreichenden Folgen das für unser Denken und Tun haben kann.
Auch Lernprozesse werden von Emotionen beeinflusst oder sogar geleitet – doch welche Gefühle helfen der Sache wirklich weiter und welche stehen dem Prozess eher im Weg?
Denn die Verbindungen sind vielleicht nicht immer ganz so eindeutig, wie wir zunächst denken mögen:
Welche Gefühle treten beim Lernen auf?
Stellen wir uns einmal folgende Situationen vor und fühlen (!) uns in zwei unterschiedliche Szenarien ein:
1.
Ich bin Student/in und bereite mich auf eine Prüfung vor. Das Fach ist nicht unbedingt mein Lieblingsthema und ich habe eventuell zu spät mit der Vorbereitung angefangen, da ich mit vielen anderen Fächern und einem Nebenjob beschäftigt war.
Es herrscht Chaos auf meinem Schreibtisch und obwohl ich denselben Abschnitt bereits dreimal gelesen habe, bleibt scheinbar keine Information hängen. Es überkommt mich bereits leichte Panik, wenn ich an die anstehende Prüfung und meine drohende schlechte Note denke.
2.
Ich bin Student/in und bereite mich auf eine Prüfung vor. Ich hatte anfangs noch Schwierigkeiten mit dem Thema, aber ich habe mich rechtzeitig durch die ersten Lernhindernisse gearbeitet.
Jetzt fühle ich sogar einen leichten Stolz, weil ich Fortschritte in einem Thema gemacht habe, das mir eigentlich gar nicht so liegt. So komme ich leichter durch den Rest der Inhalte, denn ich habe das nötige Selbstbewusstsein für das Lernen und die Prüfung.
Es ist offensichtlich, welche Situation wünschenswerter und lernförderlicher wäre. In diesen zwei Beispielen reden wir über dieselbe Person mit demselben Leistungsvermögen – und dennoch können so viele Faktoren den Lernprozess beeinflussen.
Die Lernforschung gibt uns mittlerweile vor allem auch Hinweise darauf, dass das emotionale Erleben des Lernens dabei eine zentrale Rolle spielt.
Lernen und Emotionen – eine einflussreiche Verbindung
Wenn wir Lernprozesse betrachten, konzentrieren wir uns oftmals auf die kognitiven Aspekte. Dabei gab es schon in den 80er Jahren einige Ansätze, die den Zusammenhang zwischen Lernen und Emotionen betrachtet haben.
Dabei gingen die frühesten Studien sogar noch davon aus, dass jedwede Emotion dem Lernen im Weg steht. Denn es wurde angenommen, dass Emotionen von den wichtigeren kognitiven Funktionen nur ablenken.
Dabei können wir als Menschen unsere Kognition ohnehin kaum von Emotion trennen. Wir fühlen immer und ständig, während wir denken und handeln. Es gibt wohl tatsächlich wenige Beispiele, in denen wir rein rational agieren.
Selbst Gegenstandsbereiche wie die Mathematik oder Logik betten wir meistens in Alltagskontexte ein, damit sie für uns greifbar werden. Denn die meisten Menschen haben ohne eine „Geschichte“ wenig Bezug zu reinen Zahlen.
Wenn uns der Bezug fehlt, erinnern wir schlechter und das liegt eben vor allem in unserer Emotionalität begründet: Gefühle verankern sich wesentlich stärker in uns und daher können und sollten wir auch das Lernen nicht von Emotion trennen.
In der Forschung wurde sich in jüngerer Vergangenheit dann vor allem auf den Einfluss „negativer“ Emotionen fokussiert, da wir diese häufig stärker identifizieren können. Denn auch das ist eine sehr menschliche Eigenschaft: Ängste wirken oftmals stärker auf uns als „positive“ Gefühle.
Doch zuletzt haben Studien auch versucht, genau diese besser zu beschreiben und als Katalysator für den Lernprozess einzusetzen:

Was sind Leistungsemotionen?
Eine interessante >>Studie von Craig et al. aus dem Jahr 2004 untersuchte beispielsweise diesen so einflussreichen Zusammenhang. Die Forscher:innen stellten am Ende fest, dass durch ein emotionales Erleben der Wissenszuwachs beim Lernen komplexer neuer Inhalte um 27% gesteigert werden konnte.
Solche Ergebnisse geben wichtige Indizien dafür, dass Lernerfolg maßgeblich mit Lern- und Leistungsemotionen zusammenhängt.
Emotionen sind komplexe affektiv Zustände, denen kognitiv-gedankliche, motivationale, physiologische und expressiv-mimische Anteile zugeschrieben werden.
Betten wir diese Definition in einen Kontext von Lernen und/oder eben auch Leistung ein, bezeichnen wir sie als Leistungsemotionen.
Dabei können wir zum Beispiel noch zwischen ergebnis- und aktivitätsbezogenen Leistungsemotionen unterscheiden (vgl. >>Pekrun 2006). Ergebnisorienterte Emotionen beziehen sich auf erwartete oder erlebte Ergebnisse und Rückmeldungen zu den eigenen Leistungen – beispielsweise die Frustration nach einer „verhauenen“ Prüfung.
Aktivitätsorientierte Emotionen treten konkret während des Lernens auf – also etwa die erlebte Freude bei einem Lernerfolg, wenn wir zum ersten Mal erfolgreich eine neue Tätigkeit ausführen.
Zwei weitere Dimensionen machen die Betrachtung von Leistungsemotionen komplett: Die sogenannte Valenz (positiv/negativ) und die Aktivierung (aktivierend/deaktivierend).
Daraus ergeben sich in der Folge also vier Klassen von Leistungsemotionen:
Positiv Aktivierend: z.B. Lernfreude
Positiv Deaktivierend: z.B. (übermäßige) Entspannung
Negativ Aktivierend: z.B. Angst/Ärger
Negativ Deaktivierend: z.B. Langeweile
Wie entstehen welche Emotionen?
Wir sind natürlich alle fähig zu sämtlichen dieser Emotionen und haben sie sicherlich auch alle schon in verschiedenen Lernsituationen erlebt. Doch aus welchen Gründen entsteht die eine oder andere Leistungsemotion?
Auch hierzu bietet Reinhard Pekrun einen Ansatz: Die Kontroll-Wert-Theorie. Einfach zusammengefasst gibt es hier zwei Faktoren – die subjektiv wahrgenommene Kontrolle über eine Lernsituation und die persönlich zugeschriebene Wichtigkeit.
Bereite ich mich also beispielsweise auf eine große Prüfung vor (=hohe Wichtigkeit) und fühle mich nicht ausreichend vorbereitet (=niedrige Kontrollüberzeugung), so entstehen schnell Emotionen wie Angst oder Hoffnungslosigkeit.
Geht es auf der anderen Seite um eine eher unwichtige Leistungsüberprüfung, führt die gleiche niedrige Kontrollüberzeugung eher zu Langeweile.
Diese zu Grunde liegenden Bewertungsprozesse sind natürlich extrem individuell und verlaufen auch nicht kontinuierlich in dieselbe Richtung. Unsere erlebten Emotionen können sich in ihrer Häufigkeit oder Intensität stark unterscheiden und auch stetig wechseln, während sich unsere subjektive Wahrnehmung verändert.
Für Lernbegleiter:innen sind das im Prinzip gute Nachrichten, denn wenn wir etwa die Wahrnehmung der Wichtigkeit positiv beeinflussen können, können wir auch positiv-aktivierende Lernemotionen fördern.

Welche Gefühle sind denn nun lernförderlich?
In der Klassifizierung oben haben wir bereits gesehen, dass nicht unbedingt nur positiv belegte Emotionen aktivierend sein können.
Manchmal können wir gerade durch „Angst“ vor einer Prüfung sehr zum verstärkten Lernen motiviert werden.
Trotzdem würden sicherlich die meisten Lernbegleiter:innen sagen, dass sie nicht aktiv Angst vermitteln möchten, um die Motivation zu erhöhen. Vermutlich tendierst Du ebenfalls dazu, die positiv-aktivierenden Leistungsemotionen wie Lernfreude verstärken zu wollen.
Hier kann aber übrigens auch die Dosierung eine Rolle spielen: Ein wenig kurzzeitige Überforderung, durch die sich Lernende erfolgreich durcharbeiten, kann langfristig die Motivation und das subjektive Kontrollgefühl sehr erhöhen.
Lernen muss also deshalb nicht immer „einfach sein“ oder „Spaß machen“, aber die Grundemotionen sollten nicht in die deaktivierenden Kategorien abgleiten.
Neben dem Gefühl, Lernsituationen bewältigen zu können, haben wir auch gesehen, wie wichtig die Bewertung der Wichtigkeit für Motivation und Emotion ist. Daraus können wir für uns erneut ableiten, dass Relevanz und Bedeutung der Inhalte immer so deutlich wie möglich sein sollten.
Dabei sind extrinsische Faktoren wie Prüfungen natürlich manchmal ein probates Mittel, aber noch viel effektiver für die subjektive Wahrnehmung der Wichtigkeit ist für Erwachsene der konkrete Bezug zum Berufsalltag.
Wenn wir es schaffen, positiv belegte Lernemotionen mit unseren Inhalten zu verknüpfen, können wir auf natürliche Weise motivieren und die Lernenden emotional aktivieren.













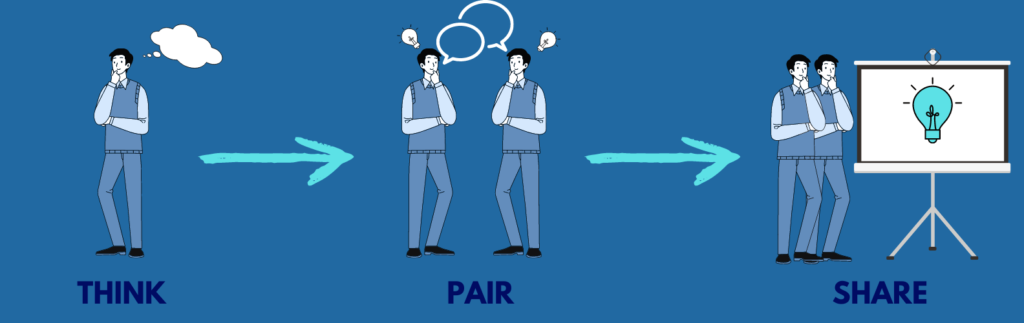





 Prof. Dr. John Erpenbeck
Prof. Dr. John Erpenbeck



